1980: Die Hauptschule Schüren gewinnt den 1. Preis im Bundeswettbewerb
Es gibt diese Familienerzählungen, die, hört man sie früh genug, sich fest verankern im Kopf und Bilder produzieren, die selbstverständlicher als die Wirklichkeit werden. Zum schmalen Erzählkanon der Schürener Großeltern gehörte dies: Nach Schüren trauten sich die Nazis nicht rein, weil sie Angst hatten vor den Sozis und den Kommunisten. Jahrzehnte später hält man ein kleines Büchlein in der Hand, was genau dieses Narrativ bestätigt – und doch auch nicht. Zu Wort kommen Zeitzeugen, die die 1930er Jahre als Kinder und Jugendliche erlebten; die als Pimpfe beim Marschieren und Exerzieren dabei waren; die im Klassenraum von einem Lehrer in SA-Uniform schikaniert wurden; die Liga-Fußball nur dann spielen durften, wenn es mit den HJ-Diensten stimmte.
Alltag im Nationalsozialismus – das preisgekrönte Projekt der Schürener Hauptschule ist selbst schon Geschichte. Die 25 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 B mit ihrem Tutor und Lehrer Friedrich Wilhelm Straeter gewannen 1980 mit diesem Projekt den 1. Preis im Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, der damals Karl Carstens hieß.
Der Alltag in Schüren änderte sich nicht auf einen Schlag: In der Großen Kolonie, gebaut um 1910 für Bergleute und Fabrikarbeiter aus der direkten Umgebung, ging es schon seit Jahren handfest zu. Und auch „(n)och nach der Machtübernahme zogen SA-Kolonnen nur unter Polizeischutz - berittene Polizei war zuweilen dabei – durch die Straßen der Kolonie, um Propaganda zu machen und um die Bevölkerung zu provozieren. Dabei wurden sie von den Bewohnern häufig mit Steinen, Unrat, Blumentöpfen, ja sogar mit Nachtgeschirren beworfen.“
Doch es kam auch zu Hausdurchsuchungen durch SA und Gestapo. Festgenommene wurden manchmal zur Steinwache nach Dortmund verbracht und dort verhört, verprügelt und gefoltert. Ein damals 12-Jähriger beschreibt die Folgen einer solchen „Sonderbehandlung“: „Ich sah, dass das Gesicht von Herrn K. völlig zerschlagen war; seine Augen waren so geschwollen, dass er kaum noch sehen konnte. Ich erkannte ihn lediglich an der Stimme wieder. Er wollte meinen Vater sprechen. (…) Mein Vater warnte mich nachdrücklichst, ja niemandem davon zu erzählen, sonst würde es mir genauso oder noch schlimmer ergehen.“
Der nationalsozialistische Staat wurde allgegenwärtig, auch wenn es nur zwölf SA-Leute in Schüren gegeben haben soll. Die Kontrolle war überall: So entging nur durch die Geistesgegenwart des Wirts der Sozialdemokrat D. einer umgehenden Verhaftung, als er sich – wie immer - weigerte, die SA-Leute in dem Lokal mit dem ausgestreckten Arm zu begrüßen. Der Gaststätteninhaber klemmte heimlich das Telefonkabel ab. „D. verließ das Lokal mit den Worten „Und immer noch Freiheit!““ Später verbrachte er als politischer Gefangener ein Jahr im Zuchthaus Werl.
Die Berichte und Geschichten beschreiben den Schürener Alltag: Fahnen und Flugblätter versteckt in Schränken; Bespitzelung der Gottesdienste und Pfarrer; Kontrolle bei der Vergabe von Arbeits- und Ausbildungsplätzen; Schikane, Vertreibung und Deportation der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Ein Zeitzeuge bewertet es so, dass die Schürener ihre kritische Haltung gegenüber den Nazis nach 1933 nicht grundsätzlich geändert hätten. Ein anderer berichtet von den Tränen der Enttäuschung seines Vaters, als dieser die aus den Fenstern hängenden Hakenkreuzfahnen zum Geburtstag des Führers 1933 sah.
Die Schülerinnen und Schüler der Hauptschule Schüren, die nun die Friedrich-Ebert-Grundschule ist, tragen aus den Gesprächen viele Details zusammen, beschreiben unzählige Alltagsgeschichten an Schürener Orten, die anschaulich machen, was Gleichschaltung und totalitäre Kontrolle auf der lebenspraktischen Ebene bedeuten. Sich zu entziehen, gelang auch in Schüren nicht. Der Preis für Opposition und Widerstand war hoch – für Erwachsene wie auch für die Kinder und Jugendlichen, die in die Parteiorganisationen eingefügt und, wenn notwendig, auch reingepresst wurden. In der Rückschau wird eine differenzierte Bewertung deutlich: Spaß und schöne Erlebnisse während der Jungvolkzeit – und heute das Gefühl, missbraucht worden zu sein für eine rechtsextreme Ideologie.
Dem Aplerbecker Geschichtsverein e. V. ist es zu verdanken, dass der Projektbericht als Buch vorliegt. Herausgegeben wurde es von Georg Eggenstein, ergänzt durch einige aktuelle Interviews, im Jahr 2015. Das ist also auch schon Geschichte – bewahrt im DinA5-Format und beim Aplerbecker Geschichtsverein zu erwerben.
Fotos mit freundlicher Genehmigung des Aplerbecker Geschichtsvereins e. V.
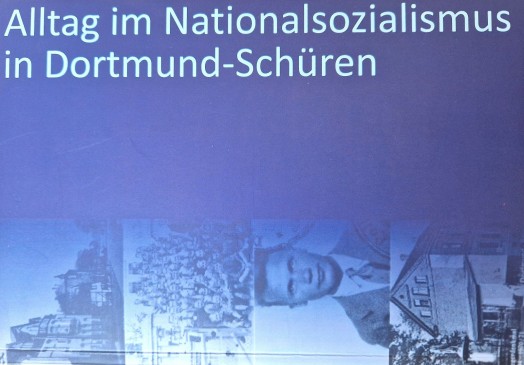

Große Kolonie, Pekingstraße, um 1980

Blick auf die kleine Kolonie
